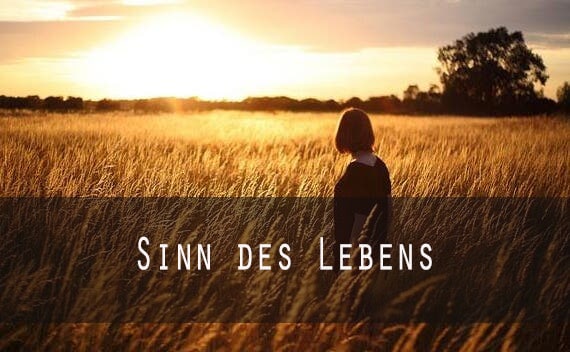Der Mensch entwickelt aus seinen Gefühlseindrücken in den ersten Lebensjahren unbewusst eine Meinung darüber, was er sich vom Leben versprechen und wie er darin eine Bedeutung bekommen kann. Er antwortet darauf mit seiner eigenen Art, das Leben zu bewältigen, mit einem Lebensstil, einem Lebensschema, einem Skript, mit dem er das ganze weitere Leben wahrnimmt, beurteilt und zu bewältigen versucht. Wer die Aufgaben des Lebens erfolgreich bewältigt, handelt so, als ob er aus freien Stücken anerkennt, dass der Sinn des Lebens Anteilnahme an anderen und Zusammenarbeit mit ihnen ist. Er scheint, bei allem, was er tut, vom Gedanken an das Wohl der Mitmenschen geleitet zu sein.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die meisten Menschen zerbrechen sich im Alltag nicht den Kopf über diese Frage. Wenn solche Fragen auftauchen wie: «Was soll das alles? Wozu mache ich das eigentlich? Gibt es nichts Sinnvolleres? Warum passiert mir das? Womit habe ich das verdient?», dann liegt meistens eine schwierige Situation im Leben vor, für die man keinen Ausweg oder nur einen sehr schwierigen Ausweg sieht oder sich generell überfordert fühlt. Solange das Leben seinen Lauf nimmt und man nicht zu grosse Schwierigkeiten sieht, stellt man solche Fragen selten, auch wenn die Frage nach dem Sinn des Lebens eine sehr interessante ist.
Bei der Frage nach dem Sinn des Lebens handelt es sich um eine sehr alte Frage. Viele Philosophen und Theologen haben sich damit befasst und haben sie verschieden beantwortet. Diese Diskussion werde ich in diesem Vortrag nur am Rande aufnehmen.
Stattdessen werde ich heute mit Ihnen besprechen, welche Antworten die psychologischen Erkenntnisse über den Menschen auf die Frage geben, was der Sinn des Lebens ist.
1. Der private Lebenssinn entsteht in den ersten Lebensjahren
Ich fasse zuerst kurz zusammen, was wir anschliessend vertiefen werden: Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht die Tatsache, dass der Mensch evolutionär bedingt ein soziales Wesen ist. Das heisst, das Leben ist natürlicherweise immer ein Leben mit Artgenossen. Die innere Stellungnahme zu den anderen Menschen hängt jedoch davon ab, wie der Einzelne in den ersten Lebensjahren alle anderen kennengelernt und welche Schlüsse er daraus gezogen hat. Der Mensch entwickelt aus den Gefühlseindrücken in den ersten Lebensjahren unbewusst eine Meinung darüber, was er sich vom Leben versprechen und wie er darin eine Bedeutung bekommen kann. Er antwortet darauf mit einer eigenen Art, das Leben zu bewältigen, mit einem Lebensstil, einem Lebensschema, einem Skript, mit dem er das ganze weitere Leben wahrnimmt, beurteilt und zu bewältigen versucht. Er folgt deshalb in allen Lebensäusserungen, in jeder Alltagshandlung, in Gewohnheiten, Zielsetzungen, im Denken, Verhalten und in allen Gefühlsäusserungen einer inneren Logik, einer Psycho-Logik. Daraus erwächst dem Menschen auch sein privater Lebenssinn. Dieser selbst gesetzte Sinn hilft ihm aber nur dann, im Leben glücklich zu werden, wenn er ihm erlaubt, mit anderen gut auszukommen und auf seine Art so eigenständig zu leben, dass dabei das Wohl der anderen immer mit einbezogen ist. Im Folgenden vertiefen wir diese Aussagen.
2. Der private Lebenssinn kann aus den Handlungen erschlossen werden
Wir stellen zuerst aus psychologischer Sicht fest, was einige sicher überraschen wird: Jeder Mensch legt sich unbewusst einen Sinn im Leben zurecht. Da wir diesen Sinn oft selbst nicht fassen können und ihn deshalb auch nicht formulieren, merken wir meistens gar nicht, dass wir genau diesem Sinn entlang leben. Einer der Begründer der Tiefenpsychologie, Dr. med. Alfred Adler, auf den ich mich im ganzen Vortrag beziehe, ohne ihn im einzelnen zu zitieren, schreibt dazu in dem sehr lesenswerten Buch «Wozu leben wir?» (S. 13) etwa folgendes: Wenn wir nicht darauf schauen, was jemand sagt, sondern die Handlungen beobachten, finden wir bei jedem einen individuellen, selbst gesetzten Lebenssinn. Alle Stellungnahmen, die Haltungen, Bewegungen, Ausdrucksformen, Manieren, Wünsche, Gewohnheiten und Charakterzüge stimmen mit diesem Sinn überein. Dieser unbewusste und selbst zurechtgelegte Sinn im Leben zeigt sich also in der Art, wie jemand denkt, fühlt, handelt, und was er anstrebt. Wir können auch sagen, jeder Mensch handelt und fühlt nicht zufällig in jeder Situation neu, sondern er bewegt sich in der Welt auf eine Art, als ob er eine Meinung über sich, die anderen Menschen und das Leben überhaupt hat. Und wir alle leben einer Überzeugung nach, wie eine Situation zu bewältigen ist.
Wenn wir uns damit genau befassen, können wir bei jedem Menschen schon in den kleinsten Situationen den Sinn erkennen, den er dem Leben gibt. Betrachten wir ein kleines Beispiel: Ein Unbekannter läuft an uns vorbei.
Wie erlebt jeder die Situation?
- Kann sich jemand freuen, einem anderen Menschen zu begegnen, und bemerken, dass der andere so freundlich in die Welt schaut? Vielleicht weil er Genugtuung und Lebenssinn darin empfinden kann, leicht mit anderen in einem guten Verhältnis zu stehen?
- Oder fühlt sich jemand belästigt, dass ein anderer seinen Weg kreuzt und er sich mit einem anderen befassen muss, wo sein Lebenssinn doch darauf ausgerichtet worden ist, möglichst wenig mit anderen Menschen zu tun zu haben?
- Oder muss sich jemand ärgern, dass der andere nicht grüsst, weil sein ganzes Gefühl und sein Denken darauf ausgerichtet worden ist, möglichst nie von anderen übersehen zu werden?
- Oder ist jemand schon darüber erfreut, dass er sich mit den anderen Menschen auch ohne Worte absprechen kann und er immer gut an anderen vorbeikommt? Vielleicht weil er einen Sinn darin findet, miteinander zu kooperieren – oder aber sein Lebenssinn liegt darin, möglichst nie jemanden zu belästigen.
- Oder meint jemand, seine Fähigkeit zur Selbstbehauptung beweisen zu müssen, und weicht deshalb keinen Millimeter von seinem Weg ab? Vielleicht weil er sich vorgenommen hat und deshalb einen Sinn darin findet, sich nie jemandem unterzuordnen, oder weil er glaubt, wichtig zu sein, wenn ein anderer auf ihn eingehen muss.
Je nach Zielrichtung im Leben, je nach persönlicher Sinngebung, wird sowohl die Wahrnehmung von anderen Menschen ausfallen als auch die Beurteilung dessen, was den anderen beschäftigt und was sich zwischen dem anderen und ihm abspielt. Deshalb schildert jeder die kleine, vorher beschriebene Situation entlang seiner eigenen unverstandenen Überzeugungen und Vorstellungen vom Leben:
- Der eine erzählt ernsthaft und vielleicht sogar empört, dass die anderen rücksichtslos und ohne zu grüssen an ihm vorbeigehen.
- Der andere erzählt davon, wie rücksichtsvoll und aufmerksam fast alle sind, so dass man gut aneinander vorbeikommt, und dass es ein paar Nervöse gibt, die absorbiert sind.
- Der Dritte erlebt solche Situationen sogar als bedrohlich und nimmt sich vor, nie mehr irgendwohin zu gehen, wenn viele Menschen unterwegs sind.
So lässt sich erklären, dass ein Partner oder ein Arbeits- oder Schulkollege, ein Freund oder ein Nachbar die ganze Welt in jeder neuen Situation immer ähnlich schildert. Er kann nicht anders, solange er seine Wahrnehmung und seine Beurteilung der Welt nicht als Folge einer privaten, unverstandenen Logik erkennen kann.
Die Betrachtung der Welt ist also nie objektiv, sondern immer von der unbewussten Überzeugung geprägt, wie die Welt funktioniert und davon, in welcher Art und Weise und wann man selbst im Leben eingreifen kann. Man kann auch sagen, das eigene Erleben ist vorstrukturiert durch eine unbewusste Weltsicht. Und die so geprägten Erfahrungen scheinen jedem seine Überzeugungen zu bestätigen. Das verunmöglicht es einem, die eigene Sicht der Welt in Frage zu stellen. Es verhindert, andere Erfahrungen zu machen, solange man sich der Art nicht bewusst ist, wie man sich die Welt zusammenbaut.
Also wenn wir herausfinden wollen, welches innere Arbeitsmodell unser Leben bestimmt, können wir natürlich nicht einfach eine einzige solche Situation herausgreifen. Da wären wir ganz ungenau und würden vor allem spekulieren. Um unsere Art der Weltsicht herauszufinden, brauchen wir mehrere solcher Situationen. Und wenn wir eine sicherere Analyse begründen wollen, müssen wir immer die gleiche innere Logik vorfinden. Aber wir können umgekehrt doch sagen, dass sich dieselbe Vorstellung von einem selbst und den anderen in jeder Situation im Leben wiederfinden wird und so auch erschlossen werden kann.
Und das ist das Erfreuliche unseres psychologischen Vorgehens, dass das Seelenleben nicht mystisch, sondern erforschbar ist. Der psychische Haushalt ist erkennbar und verstehbar. Der seelische Haushalt trägt keine unerkennbaren Geheimnisse in sich. Mit guter psychologischer Menschenkenntnis können wir uns selbst und uns gegenseitig verstehen. Damit sind wir unseren Vorerfahrungen, unseren gedächtnisgesteuerten Beurteilungen der Welt nicht mehr ausgeliefert. Wir können eine innere Logik in unserem ganzes Fühlen, Denken, Verhalten und unseren Wünschen erkennen und damit uns selbst und unsere eigene unverstandene Sinngebung verstehen.
Wiederholen wir diese Überlegungen noch einmal anhand einer anderen Situation, die in Freundschaften oft vorkommt: Daniel und Michael – zwei Freunde – waren miteinander verabredet. Daniel erhält kurzfristig eine Anfrage eines anderen Freundes, ob er ihm zum gleichen Zeitpunkt helfen könnte, ein Möbelstück zu transportieren. Er würde gerne helfen und erzählt das seinem Freund Michael. Je nachdem wie sich jemand ins Leben stellt, wird er in dieser Situation unterschiedlich reagieren:
- Einer bietet an, mitzuhelfen. In seinem Leben kann er Beziehung oder Nähe im gemeinsamen Helfen erleben. Es erscheint ihm sinnerfüllt, so zu leben. Er kommt auf die Idee, sich darauf zu freuen, die Freunde des Freundes kennenzulernen.
- Ein anderer kann nicht anders als sich abgelehnt zu fühlen. Er rechnet immer damit, dass andere ihn nicht wirklich wollen, und richtet sein ganzes Augenmerk darauf, wann das passiert. Er legt den ganzen Sinn seines Lebens in die Aufgabe, wie er die befürchtete Ablehnung so oft wie möglich verhindern kann. Im besten Fall fällt ihm spontan nur ein, möglichst neutral distanziert, aber doch verstimmt nachzufragen, ob jetzt der andere ihm wichtiger sei als er selbst. Er fordert eine Entscheidung.
- Ein Dritter unterlegt seinem Leben den Sinn, niemandem zur Last zu fallen und bleibt deshalb innerlich auf Distanz. Er findet sofort, dass sein Freund Daniel dem anderen helfen soll. Er nimmt Abstand von Daniel, indem er nicht bespricht, wie sie sich trotzdem finden können. Er sucht keine Verbindung und vertieft damit die Freundschaft nicht. Deshalb wird er dem anderen immer etwas fremd bleiben, weil der Sinn seines Lebens nicht ist, zum anderen eine Nähe herzustellen, sondern sein Sinn ist, nie ein Problem darzustellen.
- Ein Vierter hat seinen Sinn im Leben darauf festgelegt, sich von den Menschen nichts bieten zu lassen. Dementsprechend wird er sofort heftig und tischt seinem Kollegen Daniel noch andere Beispiele von früher auf, in denen er sich nicht auf ihn verlassen konnte. Ohne es richtig zu merken, versucht er Daniel damit zu zwingen, sich für ihn zu entscheiden. Sein Sinn, sich gegen die Zumutung der anderen durchsetzen zu können, verunmöglicht es ihm, sich mit Daniel abzustimmen. Er versteht sich selbst nicht, fühlt sich selbstverständlich im Recht, findet wieder wie so oft einen Beweis dafür, dass er sich immer nur durchsetzen muss, um zu seiner Sache zu kommen. Viele verwechseln diese Feindseligkeit mit Selbstsicherheit.
Die vier Haltungen sind nur einige von vielen Beispielen, wie die unverstandene innere Beurteilung des ganzen Lebens jede einzelne Reaktion im Leben bestimmt. Die Neurowissenschafterin Martha Koukkou-Lehmann, formuliert diesen Vorgang so, dass neuronale Verbindungen die Emotionen und das Denken „präattentiv“ vorbestimmen – also bevor man selber darauf aufmerksam wird.
Halten wir also fest: Unsere Beurteilung der Anderen, alles Denken über jegliche Erlebnisse, das Reden mit anderen darüber, was ich erlebt habe, welche Gefühle mir spontan aufkommen, die Überzeugung, was der andere gemeint hat – alles ist vorstrukturiert.
Dementsprechend gibt es so viele Vorstellungen vom Lebenssinn, wie es Menschen gibt. Man kann auch sagen, jeder folgt seiner unbewussten privaten Logik. Und wir gehen noch weiter: Diese unverstandenen Meinungen über den Lebenssinn sind mehr oder weniger tauglich, weil sie nur bedingt an die Realität angepasst sind. Diese persönliche Sinngebung im Leben kann mehr oder weniger hilfreich sein, das Leben positiv zu bewältigen. Sie kann zu mehr oder weniger Glücksgefühlen führen.
3. Wie kommt eine allgemeine Meinung über die Welt zustande?
Es drängt sich natürlich die Frage auf, wie diese Meinung über die Welt zustande kommt. Wie entsteht diese neuronale Vorstrukturierung der Wahrnehmung sowie die persönlichen Überzeugungen, wie man den Lebenssituationen begegnen kann? Die Antwort ist, dass sich das kleine Kind diese Vorannahmen über das Leben in den ersten 5 oder 6 Lebensjahren in der Auseinandersetzung mit den Eindrücken aus der Umwelt zurechtgelegt hat – also auch schon bevor es nachdenken konnte. Das Kind entwickelt seine Weltsicht in den ersten Jahren und meint dann schon sehr früh zu wissen, wie die Welt funktioniert. Es meint ebenfalls zu wissen, was es selbst bewirken kann und bewältigt das Leben nach seinem so entwickelten Lebensstil. Das Kind wird jedoch nicht einfach wie ein Blatt Papier beschrieben, sondern es nimmt vom ersten Tag des Lebens Eindrücke aus seinem Umfeld auf und entwickelt daraus eine immer sicherere eigene Vorstellung und Einstellung, wie es sich im Leben zurechtfinden kann.
Wenn man das weiss, kann man aus dem Lebensalltag eines Menschen erkennen, welchem unbewussten Lebensstil er folgt – was ihm wichtig und sinnvoll im Leben erscheint. Als Erzieher und Lehrender kann man daraus Entscheidendes ableiten. Es hat nur zufällig Erfolg, wenn man ein Kind oder einen Jugendlichen in eine Richtung mit verschiedensten systemischen, strukturellen oder Verhaltensregeln lenken und steuern will. Das Kind ist vom ersten Tag an selbst beteiligt, Eindrücke aufzunehmen, sie zu strukturieren und ein eigenes Weltbild zu entwickeln, mit dem es dann weitere Eindrücke wieder einordnet, verarbeitet und vernetzt. Wenn ich erfolgreich einem Kind mit Schwierigkeiten helfen will, muss ich mir immer ein Bild davon machen, welche seelische Bewegung ein Kind macht, welcher inneren Logik es folgt, welchen privaten Lebenssinn es sich zurechtgereimt hat. Eine einzelne Verhaltensweise ist immer ein Ausdruck dieses Lebenssinns. Wenn ich das Kind erfasst habe, kann ich mit dem Kind so umgehen und so mit ihm reden, dass es sich selbst verstehen lernt.
4. Welcher Lebenssinn ist den Lebensbedingungen angepasst?
Welche Sinngebung im Leben versetzt uns in die Lage, in der Wirklichkeit gut zu leben? Wirklichkeit ist für uns immer die soziale Wirklichkeit. Das Leben ist immer ein Zusammenleben. Es kommt darauf an, ob der persönliche Sinn mit der Wirklichkeit gut in Übereinstimmung steht. Der Mensch ist vom ersten Tag an darauf vorbereitet, mit den Artgenossen in eine intensive Verbindung zu kommen, und die ganze menschliche Ausstattung ist darauf ausgerichtet, in einem ständigen Austausch mit anderen zu sein. Dazu möchte ich ein paar der Besonderheiten des kleinen Kindes aufzählen, die aufzeigen, dass wir Menschen von Natur aus darauf vorbereitet sind, aufeinander bezogen zu sein und gut miteinander auszukommen:
- Der Säugling hört die Tonhöhe der menschlichen Stimme am schnellsten.
- Er kann in den ersten Wochen nur in einem Abstand von 18 bis 30 Zentimeter scharf sehen, also im Abstand von der Brust bis zum Gesicht.
- Er reagiert stärker auf bewegte Körper.
- Er reagiert am schnellsten auf ein Gesichtsschema.
- Er hat besonders viele Nervenendigungen im Gesicht, so dass es mit einer differenzierten Gesichtsmimik anderen seinen Gefühlszustand mitteilen kann.
- Es bringt keine Instinkte mit, aber kann stattdessen durch Abschauen – man sagt auch Imitieren – und durch Erklären alles lernen.
- Zudem ist der Mensch darauf vorbereitet, ab 18 Monaten in einer Art Sprachexplosion innerhalb kurzer Zeit eine Sprache zu lernen, die es erlaubt, in einen intensiven Austausch mit anderen zu kommen.
- Weiterhin besteht eine besondere Fähigkeit beim Menschen, sich in andere hineinzuversetzen, von anderen her zu empfinden, sich so zu fühlen wie andere. Es gibt nicht nur eine Gefühlsansteckung beim Menschen, also in einem bestimmten Moment die Gefühle des anderen aufzunehmen und gleich zu empfinden. Wir können uns auch in Gefühls- und Lebenszustände des anderen hineinfühlen, die wir selbst nicht kennen. Die Fähigkeit zur Empathie und damit zu einem guten Zusammenleben ist dem Menschen angeboren
- Der Mensch kann sich auch über die Vergangenheit und die Zukunft eine Vorstellung machen, sich mit anderen darüber unterhalten, sein Leben planen und sich Ziele setzen, so dass eine Kooperation mit sehr vielen und auf längere Zeit möglich wird.
- Der Mensch ist also wie kein anders Lebewesen auf einen intensiven Austausch mit anderen über das ganze Leben hinweg angelegt
Diese angelegten Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen ermöglichen es, besonders intensiv zu kooperieren und sich aufeinander abzustimmen. Dies hat es der Gattung Mensch ermöglicht, überall auf der Welt unter verschiedensten Bedingungen zu leben. In der Evolution hat der Mensch mit dieser speziell ausgeprägten Fähigkeit die verschiedensten Anforderungen meistern können und baut dies immer weiter aus. Die lange Zeit, die ein Menschenkind im Gegensatz zu anderen Säugetieren braucht, bis es erwachsen wird, ist ein Ausdruck davon, dass es lange braucht, bis es sich die ganzen kulturellen Errungenschaften angeeignet hat.
Gleichzeitig braucht es eine gute Kooperation der Erwachsenen, damit diese lange Lernzeit für die Nachkommen möglich wird. Dass wir von Anfang jedes einzelnen Lebens darauf vorbereitet sind, zusammenarbeiten zu können, hat es zudem ermöglicht, das Leben in allen Bereichen zu erleichtern und sich daran zu erfreuen: Nahrung zu beschaffen, sich vor Kälte, Regen, Sonne zu schützen, Kultur zu bilden. Es ist evolutionär gar nicht vorgesehen, dass ein Mensch alleine lebt. Die besondere Lebensform der Gattung Mensch erfordert Kooperation von jedem Einzelnen. Gleichzeitig sind wir von Natur aus darauf spezialisiert, leicht zusammenarbeiten und darin auch grosse Genugtuung erleben zu können.
Es handelt sich bei dieser Kooperationsfähigkeit um keinen Instinkt, sondern um eine angelegte Bereitschaft, die in den ersten Lebensjahren entwickelt und gefördert werden muss. Wir können uns das auch gut vorstellen: Um das Leben unter verschiedensten Bedingungen in verschiedensten Regionen der Welt zu bewältigen, braucht es Flexibilität. Eine intensive Zusammenarbeit mit verschiedensten Individuen braucht ebenfalls Flexibilität. Die zwischenmenschlichen Umgangsformen und die Art des Zusammenlebens müssen also erst ausgebildet werden, damit sie für die jeweilige Situation möglichst passend sind. Sie werden bei jedem Individuum in den langen Jahren des Aufwachsens gebildet – entsprechend der Eindrücke, die das Individuum dort erfährt. Wir können also sagen, dass es im Leben der menschlichen Art sinnvoll ist, dass jedes Individuum in den ersten Jahren des Lebens eine bestimmte Weltsicht in derjenigen Umwelt entwickelt, in der es aufwächst. Es entstehen Gefühle, die einem – bevor man denken kann – einen Eindruck der Wirklichkeit und eine Einschätzung der Situation spontan ermöglichen. Dieser Aufbau einer Gefühlsanschauung über die Wirklichkeit ist aber auch für Irrtümer anfällig.
Die Bindungstheorie hat sehr eindrücklich festgestellt, dass das gesamte Lebensgefühl von der Einführung ins Leben abhängt: Sind Beziehungspersonen zugewandt, hat ein Kind mit 3 Jahren Freude am Zusammensein. Es erlebt überhaupt etwas in seinem Leben, weil seine Erlebnisse für jemanden interessant sind. Es ermöglicht mit seiner Art des Redens, dass der andere einen Dialog aufnehmen kann. Es kann sich mit anderen abstimmen und findet deshalb leichter gemeinsame Wege, zum Beispiel beim Spielen. Deshalb baut es schönere Freundschaften auf, fühlt sich wohler im Leben, kann schwierige Situationen im Leben ruhiger bewältigen und geht mutiger auf Neues zu. Kinder, deren Eltern innerlich distanzierter sind, nervöser und unruhiger im Leben stehen, sich schnell in Frage gestellt fühlen und sich vorrangig mit ihren eigenen Problemen beschäftigen, vermitteln ihren Kindern durch das alltägliche Gefühlsumfeld eine Distanz zum anderen Menschen. Diese Kinder empfinden weniger in ihrem Leben, erleben also weniger, haben weniger Ideen, wie sie mit anderen auskommen können, sind schneller frustriert und haben es schwerer, anderen Menschen näher zu kommen.
Diese offene, unter den jeweiligen Umständen anzupassende Fähigkeit des Menschen, sich das reale Leben einer Weltsicht gemäss vorzustrukturieren, kann also einen Menschen dazu führen, sein Leben irrtümlicherweise auch so auszurichten, dass er sogar versucht ist, sich von der Kooperation teilweise oder ganz auszuschliessen, insbesondere wenn er in seinen Kindheitsjahren die Kooperation nicht als erfüllend kennengelernt hat.
In verschiedensten Regionen der Welt haben sich im Laufe der Jahrtausende sogar in ganzen Kulturen Zielrichtungen des Lebens etablieren können, die dem naturgegebenen Prinzip der Kooperation und Geselligkeit widersprechen. Man glaubte zum Beispiel, dass der Mensch als Ideal das einsame, von anderen Menschen ungestörte Leben anstreben sollte – sei es der zurückgezogene Mönch und die Nonne im christlich-abendländischen Denken, oder der in sich versunkene, abseits der Menschen lebende Buddha oder Zen- oder Yogameister.
Warum behaupte ich, dass solche Arten von privater Sinngebung zum Leben nicht passen und deshalb den Menschen nicht glücklich machen können?
Wir müssen aus evolutionärer Sicht feststellen, dass wir in allem aufeinander bezogen sind, da das Einzelwesen nicht in der Lage wäre, das Leben zu meistern, und auch nicht darauf angelegt ist, das zu tun. Auch der Zurückgezogene, der Introvertierte, lebt von denen, die ihre Arbeit immer auch für ihn eingesetzt haben, indem er die von anderen erzeugten und verteilten Nahrungsmittel isst, in einer von anderen erbauten Wohnung lebt und von anderen erzeugte Wohnungseinrichtungen benutzt, sich auf von anderen erbauten Strassen mit von anderen produzierten Verkehrsmitteln bewegt und das von anderen installierte Licht und Wasser benutzt.
Der allein Lesende liest die Bücher von anderen. Wer meint, er mache sich seine eigenen Gedanken übersieht, dass er nur das denken kann, was er im Laufe seines Lebens von anderen schon gehört hat. Seine Überlegungen bauen höchstens auf denjenigen anderer auf. Das Leben ist so gestaltet, dass sich niemand der Zugehörigkeit zu anderen Menschen entziehen kann. Und wie bereits erwähnt, ist auch das ganze Denken, Fühlen und Handeln Resultat der Erlebnisse mit den Mitmenschen.
Wir Menschen sind also darauf angelegt, mit den anderen das Leben gemeinsam zu gestalten und mit den anderen Menschen gut auszukommen. Dafür sprechen auch psychologische Forschungsresultate, welche gezeigt haben, dass die Lebenszufriedenheit sowie die Gesundheit, ja sogar die Lebensdauer eines jeden Menschen mit der Anzahl befriedigender mitmenschlicher Beziehungen steigt. Man kann deshalb naturwissenschaftlich feststellen, dass der Mensch dann am glücklichsten ist, wenn er in Verbundenheit und in guter Zusammenarbeit mit seinen Mitmenschen lebt.
Die Aussage, dass wir als Menschen auf Gemeinschaft angelegt sind, ist also nicht als eine Pflicht oder als moralische Belehrung zu verstehen, sondern als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung, die besagt, dass es eine natürlich vorhandene Ausrichtung der Menschen auf ihre Artgenossen gibt, die ihnen ein so erfolgreiches Leben auf unserem Planeten ermöglicht hat.
Jeder möchte also von Natur aus in Beziehung mit dem anderen stehen und erlebt dabei das grösste Glücksgefühl. Seine Bedeutung erlebt der Mensch durch ein Gegenüber. Fehlt das emotionale Gegenüber, dann stirbt das Kind nach Monaten oder Jahren. Deshalb gibt die Mitarbeit für das gemeinsame Wohl dem Einzelnen seine grösste Bedeutung. Um das Leben gut zu bestehen und vor allem glücklich zu sein, muss ein Mensch in die Lage gesetzt werden, dieses natürliche Konzept auch ausleben zu können, sich darin zu üben, mit anderen kooperieren zu können. Er muss ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln können. Das bedeutet, den Sinn im Leben darin zu empfinden, dass man den anderen Menschen nahe kommt, sich mit ihnen zusammentut, den anderen hilft und von ihnen geholfen bekommt, und ganz grundsätzlich mit anderen verwurzelt ist und das Leben teilt. Ein solches Ziel steht in Übereinstimmung mit der natürlichen Ausrichtung des Menschen auf seine Artgenossen.
Wir haben also mit dem Gemeinschaftsgefühl einen wissenschaftlichen Massstab dafür, ob der persönliche Lebenssinn oder das persönliche Lebensziel für das Leben sinnvoll ist oder nicht. Ist das unbewusste Lebensziel des Menschen auf das Wohl des Ganzen ausgerichtet, spricht man deshalb auch von adaptiven Mustern. Stellt sich der Mensch mit seiner unverstandenen Weltsicht immer wieder gegen das allgemeine Wohl, spricht man von maladaptiven Mustern.
5. Irrtümer in der unbewusst entwickelten, persönlichen Sinngebung
Bei jedem Menschen haben sich in der Kindheit bei der Entwicklung dieses persönlichen Lebensinns oder Lebenskonzepts Irrtümer eingeschlichen, die das Leben unter Menschen erschweren oder verunmöglichen. Diese Fehlmeinungen sind entstanden, weil das Wissen über die Erziehung und die Natur des Menschen in unserer Kultur noch relativ wenig ausgebildet ist. Wir Erzieher sind meist noch zu wenig in der Lage, den Kindern ein gemeinschaftliches Leben nahebringen zu können. Deshalb ist fast jeder und jede in der eigenen Person und im Vertrauen zu den anderen verunsichert. Es fällt schwer, sich nur schon vorzustellen, wie man gleichwertig, eigenständig und frei zusammenleben kann. In jeder Partnerschaft, in jeder Freundschaft, in der Erziehung und im Schulzimmer, in den Betrieben, in jedem Zusammenschluss von Menschen zeigen sich deshalb all diese Missverständnisse und Fehlhaltungen. Die psychologische Aufklärung soll dazu dienen, diese Irrtümer zu erkennen, um besser zusammenleben zu können.
Ich möchte Ihnen gerne im Folgenden genauer schildern, wie sich Fehler beziehungsweise Irrtümer im Lebenskonzept durch eine verfehlte Erzieherhaltung in den ersten Lebensjahren einschleichen und wie sich diese im späteren Leben auswirken können. Ich möchte Ihnen damit aber auch nahebringen, dass Schwierigkeiten und Unglücke im Leben sehr gut verstehbar und erklärbar sind. Mit diesem Wissen um die Fehlinterpretation können sie auch behoben werden.
5.1 Entstehung von Irrtümern durch eine kritisierende und vernachlässigende Erziehung
Erfährt ein Kind in den ersten Lebensjahren wenig Zuneigung oder viel Kritik, entwickelt es Vorbehalte und grosse Ängste vor den Menschen. Es findet deshalb vielleicht seinen Lebenssinn darin, möglichst nie auf andere Menschen angewiesen sein zu müssen. Ein solches vernachlässigtes Kind erlebt nie oder selten, was Liebe und Gemeinschaft sein kann. Das befriedigende Gefühl, mit anderen ohne Ängste und Vorbehalte und frei zusammensein zu können, kommt im eigenen Leben dann nicht vor. Entsprechend unterschätzt es oft die eigenen Fähigkeiten und was es mit anderen bewältigen kann. Es überschätzt meistens die Anforderungen des Lebens. Es erwartet, dass die Mitmenschen oder sogar die Gesellschaft kalt und unmenschlich sind. Das liegt auch daran, dass es nicht weiss, dass es Liebe und Achtung gewinnen kann, indem es so handelt, dass es anderen nützt. Deshalb wird es immer misstrauisch sein und an mangelndem Selbstvertrauen leiden. Ist die Erziehungshaltung kritisierend und ablehnend, kann ein solches Kind einen Sinn im Leben darin finden, alles daran zu setzen, die Eltern in jedem Augenblick zufriedenzustellen und alle eigenen Wünsche zurückzustellen. Es kann so weit gehen, dass ein Mensch gar keinen Sinn darin sehen kann, ein eigenes Leben zu führen, Überlegungen selbst anzustellen und mit anderen auszutauschen. Ja, es kann sogar so weit gehen, dass eigene Gefühle dem unbewussten Lebenssinn widersprechen. Der Sinn besteht dann darin, dem anderen immer zu genügen oder vor allem Genugtuung zu erleben, mit dem anderen in Übereinstimmung zu sein oder gar immer zu gehorchen. Ein solcher Mensch kann nicht eigenständig zu einem freien Zusammenleben beitragen. Erich Fromm und andere haben diese Haltung «autoritären Charakter», Theodor W. Adorno «autoritäre Persönlichkeit» genannt.
Kritisierende und lieblose Eltern haben die Aufgabe verpasst, im Kind Teilnahme, Zuneigung und den Sinn für Zusammenarbeit hervorzurufen, so dass es für das Kind schwierig ist, freundschaftliche Gefühle zu entwickeln. Sein Misstrauen gegen die anderen kann sich nicht nur darin zeigen, dass er introvertiert lebt, sondern kann sich auch in Distanziertheit zeigen oder in Besserwisserei und einem Streben, andere unterzuordnen. Er erlebt seinen Lebenssinn darin, nie mehr zuzulassen, dass sich ihm jemand annähern kann. Er wird solche Ziele unbewusst auch in einer Partnerschaft anstreben und wird damit scheitern. Es kann sich auch auf das sexuelle Empfinden auswirken, dass jemand danach strebt, den anderen unterzuordnen oder sogar zu plagen. Oder die Distanz zum anderen kann ein sexuelles Empfinden mit dem Gegenüber verunmöglichen und es braucht perverse Stimulation, um überhaupt etwas empfinden zu können.
Da ein solcher Mensch von seinem unverstandenen Lebensstil nicht Abstand nehmen kann, muss er sich eine Rechtfertigung für sein Scheitern suchen: Er behauptet zum Beispiel, Partnerschaften würden ihn einengen oder die Männer bzw. Frauen seien nicht interessiert oder seien eben nicht zu gebrauchen. Er muss sich überall entfernen, wo ihm jemand nahetritt, bleibt unerreichbar und kann unter den Menschen damit zu wenig Geltung erreichen, weil sich ihm niemand anvertrauen möchte und er wenig gefragt ist.
Wie jeder die Erlebnisse einer kritisierenden und vernachlässigenden Erziehung deutet, ist verschieden. Welchen Schluss einer unbewusst für sein eigenes Leben zieht und welche Ziele er daraus ableitet, ist individuell: Einer findet, er setze alles daran, dass er nie mehr kritisiert wird oder es zumindest nicht mehr bemerken will. Ein anderer meint, dass er Kritik und Ablehnung auch überstanden hat und andere sich nicht so schwächlich geben sollen. Ein Dritter wiederum legt sein ganzes Gefühlsleben unbewusst darauf an, die Welt genauso zu behandeln, wie sie ihn behandelt hat und rechtfertigt sein destruktives Handeln manchmal sogar mit der Bösartigkeit der anderen. Ein Vierter folgert aus seinen kindlichen Erlebnissen unbewusst, dass er es schwer hatte oder hat und ihm jeder helfen sollte.
Für die psychologische Einsicht in das menschliche Gefühlsleben ist in diesem Zusammenhang also hervorzuheben: Das kindliche Umfeld liefert das Material, aus dem das Kind unbewusst einen eigenen Sinn fürs Leben ableitet. Die erzieherischen Einflüsse sind deshalb nicht determinierend für den Charakter, die Ziele und den persönlichen Sinn im Leben. Der Mensch zieht zufällig aus denselben Umständen andere Schlüsse und richtet sich dementsprechend anders im Leben ein. Wir leiden also nicht an einem Schock aufgrund der Erfahrungen oder an einem Trauma, das wir einmal oder mehrfach erlebt haben. Vielmehr ziehen wir aus unseren Erfahrungen Schlussfolgerungen, denen wir uns selbst unterwerfen und die wir unbewusst immer wieder von neuem dem Leben überstülpen – solange wir das nicht erkennen. Wir legen uns also – ohne es zu merken –, selbst fest durch den Sinn, den wir dem Leben geben.
Die lieblose Erziehung kann das Kind so weit in Gegenstellung zu anderen Menschen führen, dass es sich aus dem Leben heraushält. Wenn dieser Rückzug vor anderen Menschen sehr stark wird und keinerlei Ausblick besteht, dass sich etwas ändern könnte, kann es passieren, dass ein Mensch sich gezwungen sieht, sich sogar ganz aus dem menschlichen Zusammenhang und damit aus der Realität herauszulösen, was psychotisch genannt wird. Frau Dr. med. Lilly Merz, Psychiaterin, hat zum Beispiel ihre Dissertation über paranoid-psychotische Patienten geschrieben, die im Jahre 1915 und 1945 im Burghölzli, in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, behandelt wurden. Sie hat dabei festgestellt, dass ein grosser Teil davon Verdingkinder waren. Diese hatten so wenig Zuneigung und Liebe erfahren, dass sie zu den Menschen und damit zum ganzen Leben jegliches Vertrauen verloren hatten. Je nach dem zufällig entstandenen Lebenssinn zogen sie sich gehäuft vom Leben zurück und wurden psychotisch. Häufig wurden sie schon von den eigenen Eltern lieblos und hart erzogen. Da die Verdingkinder oft schlechter als die Tiere behandelt wurden erlebten sie nur sehr wenig emotionale Beziehungen. Sie zogen teilweise den Schluss daraus, sich gar nicht auf andere verlassen zu können und allen Menschen misstrauisch begegnen zu müssen. Interessanterweise zogen andere aus diesen Erlebnissen ganz andere Schlüsse. Sie setzten bei ihren Kindern und oft im gesellschaftliche Leben alles dafür ein, dass es anderen nicht so ergehen solle wie ihnen und entwickelten eine besondere Freude, Empathie und Hilfsbereitschaft für andere. Oft wurden sie erfolgreich in ihrem Beruf und schufen sich viele Freunde.
5.2 Entstehung von Irrtümern durch eine verwöhnende und verzärtelnde Erziehung
Wird einem Kind eine Welt vorgeführt, in dem alle seine Wünsche ohne eigenen Beitrag erfüllt werden, fühlt es sich meist überall sehr schnell abgelehnt. Sein Lebenssinn besteht dann darin, die anderen mit Charme oder Ärger bzw. Beleidigtsein dazu bringen zu können, die Herausforderungen im Leben für es selbst zu verringern oder ganz zu lösen. Das wird scheitern und doch kann es nicht anders als seine Bewegungslinie fortzusetzen, wenn ihm der psychologische Vorgang nicht bekannt ist. Ein solcher Mensch muss sich entweder auf wenige Menschen beschränken, zum Beispiel auf eine Partnerschaft oder einen hilfsbereiten Chef, wo dieses unbewusste Ziel erreichbar ist oder muss sich vom Leben zurückziehen, zum Beispiel durch eine Depression.
Ein solches Kind lebt in der Meinung, dass andere dazu da sind, ihm immer etwas zu bieten. Es wird in der Lebenskraft geschwächt, weil ihm von früh an alle Leistungen abgenommen worden sind. Es muss deshalb seine Kraft darauf legen, immer wieder jemanden zu finden, der ihm etwas erledigt, was es sich selbst nicht zutraut. Ohne es zu merken, haben die Eltern dem Kind Gelegenheit gegeben, schon früh den Eltern seine Meinung aufzuzwingen. So wird es das ganze Leben lang versuchen und seinen Lebenssinn darin finden, dass es von anderen leben kann. Es wird jedoch meist Erlebnisse machen, dass andere auf diesen Wunsch nicht eingehen. Es entwickelt zum Beispiel eine zögernde Attitüde, weil ihm vom ganzen Fühlen, Denken und Handeln her nicht naheliegt, die eigene Haltung zum Leben zu verändern, selbst wenn es dazu aufgefordert wird oder man sogar versucht, es zu zwingen.
Wir können oft beobachten, dass sich ein verzärteltes Kind durch eine Aufforderung, etwas Kleines zu ändern, so abgelehnt fühlt, dass es eine richtige Wut entwickelt, da seine ihm ursprünglich vorgeführte Welt nicht mehr stimmt. Viele Eltern oder Lehrende können feststellen, dass ein solches Kind kurze Zeit später wieder sehr liebenswürdig sein kann, nämlich dann, wenn es meint, auf diese Art Zuwendung zu erhalten. Meistens versteht man bis heute nicht, dass beides aus der Not geboren ist, die anderen immer für sich einnehmen zu müssen, um sich wohl fühlen zu können. Im Grunde genommen stehen solche Kinder im Streikzustand gegen die Gemeinschaft, weil sie es als Zumutung erleben, ganz normale Menschen mit normalen Aufgaben zu sein. Sie können im Zusammenleben und Sich-Aufeinander-Abstimmen zu wenig oder nichts Positives erleben. Die daraus folgende Unruhe, oft verbunden mit Konzentrationsschwäche und Aufmerksamkeitsstörungen, ist also Folge eines verfehlten Lebenssinns, der schwer ermöglicht, im Zusammenleben mit anderen Genugtuung zu erleben. Bei Kindern lautet die Diagnose heute in solchen Fällen oft Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom „ADS“, wenn sie eher zurückgezogen sind. Wenn sich solche Kinder mit viel Aufwand und grosser äusserer Nervosität damit beschäftigen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sich auch deshalb wenig mit dem Leben befassen können, diagnostiziert man sie eher mit „ADHS“, weil sie dann hyperaktiv erscheinen. Wir sehen diese Diagnosen – genauso wie die Verfasser der Diagnoseschlüssel ICD Und DSM – nicht als Krankheit an, sondern als Namen für eine bestimmte Anzahl und Häufigkeit von bescheiebenen Symptomen, deren Ursachen zu erforschen sind. Wir betrachten diese Verirrungen generell als verfehlte Einführung in das Gemeinschaftsleben.
Andere sind sehr aktiv, lehnen sich offen dagegen auf, dass sie nicht ständig besondere Beachtung und Zuneigung erfahren. Sie fühlen sich deshalb im Leben schon sehr früh betrogen. Das kann so weit gehen, dass sie die Gesellschaft als ihren Feind betrachten und versuchen, sich an allen Menschen zu rächen. Ohne selbst zu wissen, warum sie solche schlechten Gefühle auf andere Menschen haben, gehen sie auf andere Kinder los, beschimpfen Eltern, Lehrer oder Lehrmeister. Irgendwelche Massnahmen, Verträge über ein besseres Verhalten, Anmahnungen einzeln, in Klassen bzw. Teams oder gar heftigere Bestrafungen sind deshalb wirkungslos. Sie können nur die Überzeugung bei diesen Kindern bekräftigen: „Die anderen sind gegen mich!“ Bei allen Handlungen bemerkt man den Irrtum im Lebenssinn. Man bemerkt ihn, ob sie streiken oder offen revoltieren, ob sie mit Schwäche in den Mittelpunkt treten wollen oder sich gewaltsam rächen. Sie meinen nur leben zu können, wenn man sie irgendwie beachtet.
Das Bestreben, irgendwie besonders hervorgehoben zu sein, ist leider weit verbreitet. Es kann nur beruhigt und aufgelöst werden, wenn es gelingt, mit anderen zusammen Erfolge im Leben zu erreichen. Ein Kind vor den Anforderungen des Lebens zu schützen, indem es von bestimmten fehlenden Leistungen lernbefreit wird, ist eine Kapitulation vor dem verfehlten und mutlosen Lebenskonzept eines Kindes. Die Korrektur eines Irrtums wird damit auf einen späteren Zeitpunkt im Leben verschoben, an dem das Problem noch deutlicher und eingeschliffener zutage tritt. In Fällen, in denen viel Aktivität zusammenfällt mit einer starken Abneigung gegen die Gesellschaft und wenigen Erlebnissen, durch Mitarbeit am Ganzen eine Bedeutung zu bekommen, führt eine solche Haltung in eine Kriminalität.
Wir können also auch umgekehrt vorgehen und bei einem Problem eines Menschen untersuchen, in welcher Art und Weise in der Kindheit ein Mangel entstanden ist, mit anderen zusammenarbeiten zu können.
6. Veränderung der Irrtümer im Lebenssinn
Man kann niemandem einen Vorwurf machen, dass er entsprechend seinem Lebensstil lebt. Der Mensch baut sich zwar seine Weltsicht zusammen, aber bevor er denken kann. Er verwendet das vorgefundene psychische Material in seinem Umfeld und versucht, sich so gut wie möglich im Leben zurechtzufinden. Er kann nichts dafür, wenn er andere als Gegner erlebt, wenn er glaubt, sich gegen andere wehren zu müssen, wenn er – eifersüchtig auf andere und unbeachtet und unterschätzt sich fühlend – ihnen das Leben erschwert. Appelle, sich besser zu verhalten, nützen deshalb meist wenig oder nichts.
Jeder Mensch muss sich in seiner Art, auch seiner holprigen Art, verstanden fühlen. Es nützt auch nur zufällig, wenn man meint, ein schlagendes Kind gäbe es nur so lange, wie die anderen es ablehnen. Es nützt auch nur zufällig, wenn man anderen zuschiebt, sie sollten das schlechte Verhalten tolerieren oder damit leben. Genauso zufällig hilft es, einfach das Kind in eine anderes Situation zu bringen in der Meinung, andere Umstände würden es ändern. Es hilft auch nur sehr wenig und vorübergehend, einem solchen Kind wieder eine verwöhnende Situation zu schaffen, in der es zum Beispiel von einem speziellen Betreuer oft einzeln besonders gefördert wird. Leider kann das Kind damit seinen Gefühlsirrtum nicht ändern. Denn ein Irrtum in der Bewältigungsart des Lebens wird nicht in der Einzelsituation besonders deutlich, sondern in der Gemeinschaft. Es nützt nicht viel zu erfahren, dass ein solches Kind auch sehr nett und aufgestellt sein kann, wenn es alleine betreut wird. Das hilft nur dann und vor allem den Betreuern, falls sie ein schlechtes Bild und ablehnende Gefühle auf das Kind haben.
Eine Veränderung im Gefühlsleben kann nur stattfinden, wenn sich der Mensch in seinem Irrtum im Lebenssinn erfasst fühlt und merkt, dass das Gegenüber seine verfehlte Gefühlslogik aufdecken kann und seine Distanz zu anderen in seinem Lebensstil erfasst. Erst dann kann man mit ihm zusammen einen Ausweg aus dieser Fehlbeurteilung von anderen und dem Leben erarbeiten. Dem Kind muss zum Erlebnis verholfen werden, dass es unter anderen Menschen eine positive Bedeutung erhalten kann, wenn es für die anderen mitdenkt, mitfühlt und für sie etwas unternimmt. Es muss angeregt werden, mit Mut und Entschlossenheit aus seinem Gefühlsirrtum heraus zu wollen, wenn es einen dem Leben angepassteren Ausweg vor Augen geführt bekommt.
Man kann auch als Erwachsener nur dann seinen verfehlten Lebenssinn verändern, wenn man anhand verschiedener Beispiele durchdenkt, worin eine falsche Deutung des Lebens liegt. Beispielsweise wenn man meint, der Kollege würde einen ablehnen, obwohl er jede Frage gerne beantwortet. Um sich mit falschen Deutungen im Leben zu befassen, braucht es meistens einen Anlass zur Veränderung. Und das passiert, wenn man Probleme im Leben nicht lösen kann. Wenn jemand keinen Partner findet oder sich ständig schnell trennt, weil ihm die Gefühle abhanden kommen oder er sich ständig streitet. Oder wenn er im Beruf darauf hingewiesen wird, dass er nicht richtig mitmacht, dass er sich nicht abspricht. Aus den zugrundeliegenden Gefühlen herauszutreten, ist fast nie nur aus eigener Kraft möglich. Meistens braucht es eine Fachperson, die im Verstehen dieser Sinngebung geübt ist, die sich an der Aufdeckung des zugrundeliegenden Irrtums beteiligt und eine angemessenere Sinngebung vorschlagen kann.
Wenn ein Mensch aufgrund solcher Kindheitseindrücke ein Misstrauen zum Menschen aufgebaut hat und davon Abstand nehmen will, dann muss der ursprüngliche Irrtum aufgedeckt werden, dass die anderen darauf aus sind, einen zu kritisieren. Stattdessen ist es notwendig, ein gemeinschaftlicheres und mutigeres Leben einzuüben. Das Gemeinschaftsbewusstsein ist der einzige Schutz gegen verschiedenste neurotische Neigungen wie Rückzug, Depression, Abwertung von anderen, Nervosität, usw. Häufig kommt jemand im Leben nicht weiter oder scheitert sogar, weil die Anteilnahme an der Gemeinschaft fehlt. Er glaubt, die Aufgaben des Lebens – die Arbeit, die Freundschaft und die Liebe – alleine lösen zu können oder lösen zu müssen. Es fehlt die Überzeugung, dass diese Aufgaben durch gemeinschaftliche Bemühungen gelöst werden können.
Für die gesamte Kultur ergibt sich eine wichtig Ableitung aus unseren Überlegungen. Es kommt darauf an, wie viele Menschen in ihrer individuellen Sinngebung dann Genugtuung zu erleben, wenn die anderen einbezogen sind und bei allen Aktivitäten die Wirkungen auf das menschliche Zusammenleben mitempfunden und mitgedacht wird. Es hängt davon ab, wie folgende Fragen im Gefühlsleben beantwortet werden:
- Fühlt sich ein Mensch wohl und sieht er es als Selbstverwirklichung an, wenn er anderen eine Freude machen kann?
- Freut er sich, wenn er andere beim Autofahren mit einbezieht, beim Einkaufen den Verkäufer beachtet oder den anderen Kunden, oder sich gerne aufeinander abstimmt, wenn man durch die Strassen läuft. Oder fühlt man sich immer im Gegenteil belästigt, eingeschränkt oder bedroht?
- Ermöglicht es der eigene Lebenssinn, sich in seinem Beruf für die Kunden einzusetzen und deren Wohlbefinden zu fördern?
- Lässt es der eigene Lebensentwurf zu, sich für den Partner zu interessieren, beim Partner mitzuschwingen und ihm das Leben zu verschönern?
- Wird es einem wichtig, wie der Freund und Kollege fühlt, was ihn beschäftigt?
- Komme ich auf die Idee, dass ich den anderen in mein Leben mit einbeziehe, weil es mich stärkt?
- Kann ich mich überhaupt für die Menschen im Dorf, im Quartier, aber auch in der ganzen Welt interessieren?
- Gibt es mir einen Sinn, befriedigt es mich richtig, ist es ein innerer Wunsch, andere miteinzubeziehen, bei anderen mitzudenken, sie in mein Leben hineinzunehmen und dabei mitzuhelfen, wie man Herausforderungen lösen kann?
Wir sehen hier: Die individuelle Lösung der Sinnfrage, wie sich jeder einzelne das Leben einrichtet, wie weit in seinem Lebenssinn das Mitdenken, Mitfühlen und die Mitarbeit, die Kooperation mit anderen selbstverständlicher Teil ist, bestimmt das Schicksal der Menschheit und ihre Wohlfahrt. «Je grösser der Fehler in der Sinngebung, um so mehr Verwicklungen drohen dem Träger eines fehlerhaften Lebensstils», schreibt Alfred Adler im Buch «Der Sinn des Lebens» (S. 9). Auch eine Kultur kann daraufhin untersucht werden, inwieweit diese passende Sinngebung in der Erziehung gelegt wird. Je mehr das für jeden Einzelnen gelingt, umso besser kann die Gesellschaft eingerichtet werden, umso mehr eigenständige Zusammenschlüsse zur Lösung von Probleme werden vorhanden sein, weil es mehr Menschen gibt, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen können, sei es im Beruf, in der Zivilgesellschaft, in der Liebe.
Umgekehrt ist es auch so, dass die vorhandene Kultur die Sinngebung jedes Einzelnen darin lebenden Individuums stark beeinflusst, da ja der individuelle Lebensstil vom Kind aus dem vorgefundenen Material entwickelt wird. Das bedeutet, je mehr Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Angst, Schrecken und Gewalt in einer Kultur selbstverständlich sind, umso eher entsteht ein individueller Lebenssinn, der an diese Situation angepasst ist. Krieg und Vertreibung, Hunger und existentielle Unsicherheiten, Unterschiede in der Behandlung von Geschlechtern, von Rassen und Herkunft, Abwertung bestimmter Meinungen politischer oder anderer Art, eine ständige Stimmung der Bedrohung zum Beispiel durch Umweltschädigungen oder anderes geben dem Kind das falsche Material in die Hand und tragen dazu bei, dass es das Kind schwerer hat, in seinen unbewussten Lebensplan eine Mitarbeit unter den Menschen einbauen zu können.
7. Wirkung der Erziehung zum Gemeinschaftsleben
Wird ein Kind vom ersten Tag an angeleitet, sich für andere zu interessieren, im Alltag auch in schwierigen Situationen mit anderen zusammenzuwirken, mutig möglichst viele Fähigkeiten zu entwickeln, die es eigenständig machen und die auch anderen zugute kommen, dann fühlt es sich motiviert, das Leben mit anderen gut gestalten zu können. Es wird zeitlebens viel Austausch und Glück erleben können.
Ein solches zur Mitarbeit angeregtes Kind wird stets, von sehr hohen Anforderungen abgesehen, sein Leben im Sinne seiner Meinung vom richtigen Gemeinschaftsleben gestalten.
Alfred Adler schreibt dazu im Buch «Wozu leben wir?», S. 16: «Ein solcher Mensch kann dann das Liebesleben als innige und beziehungsreiche Gemeinschaft erleben, in der andere dazugehören und das Interesse an den Weltfragen miteinbezogen ist. Er kann dann im Beruf eine nützliche Leistung für alle anstreben und umsetzen. Auch wird er viele Freunde finden und Kontakt entspannt und fruchtbar aufnehmen. Ein solcher Mensch empfindet sein Leben dann als schöpferische Aufgabe, die ihm viele Gelegenheiten und Chancen gibt und keine endgültigen Niederlagen. Er wird nicht darin seinen Erfolg suchen, im Guten oder im Schlechten aufzufallen. Sein Leben in der Gesellschaft wird stets von seinem Wohlwollen begleitet sein, auch wenn er gegen solche seine Stimme erheben wird, die das Zusammenleben stören. Auch der gütige Mensch kann sich bisweilen der Verachtung nicht entschlagen: Leben heisst dann: Anteil nehmen an den Mitmenschen, Teil des Ganzen zu sein, nach Kräften zum Wohl der Menschheit beitragen.»
Wer die Aufgaben des Lebens erfolgreich bewältigt, handelt so, als ob er aus freien Stücken anerkennt, dass der Sinn des Lebens Anteilnahme an anderen und Zusammenarbeit mit ihnen sei. Er scheint, bei allem, was er tut, vom Gedanken an das Wohl der Mitmenschen geleitet zu sein, und wo Schwierigkeiten auftreten, sucht er sie mit Mitteln zu überwinden, die mit den Interessen der Menschheit im Einklang sind.
8. Das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft
Zum Schluss möchte ich noch kurz das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft beleuchten: Was ist mit dem Individuum in dieser Sinngebung? Leidet nicht die Individualität, wenn man immer an die Interessen der anderen denkt? Geht es nicht darum, die eigenen Interessen zu wahren und die eigene Persönlichkeit zu stärken?
Es handelt sich hier um ein Scheinproblem. Je mehr der Mensch in der Lage ist, seine Lebensziele darauf zu richten, die anderen in seinem Fühlen, Denken und Handeln dabei zu haben, umso mehr kann er seine Individualität entfalten. Er kommt dann mit seinem persönlichen Lebenssinn oder Lebensziel nicht ständig in Konflikt mit anderen und muss nicht immer zurückstehen. Er kann seine Fähigkeiten viel freier und leichter ausbilden, die ihm gleichzeitig den Zugang zu anderen ermöglichen. In den Untersuchungen der Bindungsforscher zeigt sich, dass derjenige, der sich gut mit den Menschen zurechtfindet, für sich viel mehr Glück empfinden kann und gleichzeitig auch seine eigenen Überlegungen, Meinungen und Interessen offen, weil angstfrei, einbringen kann. Ein Lebenssinn, der in Übereinstimmung mit einem Gemeinschaftsleben steht, ermöglicht also die beste Entfaltung von Eigenständigkeit.